Erstellung Betriebskonzept für Standortaufbau
Facility Management: Evakuierungen » Evakuierungskonzept » Erstellung eines Betriebskonzepts für einen neuen Standort
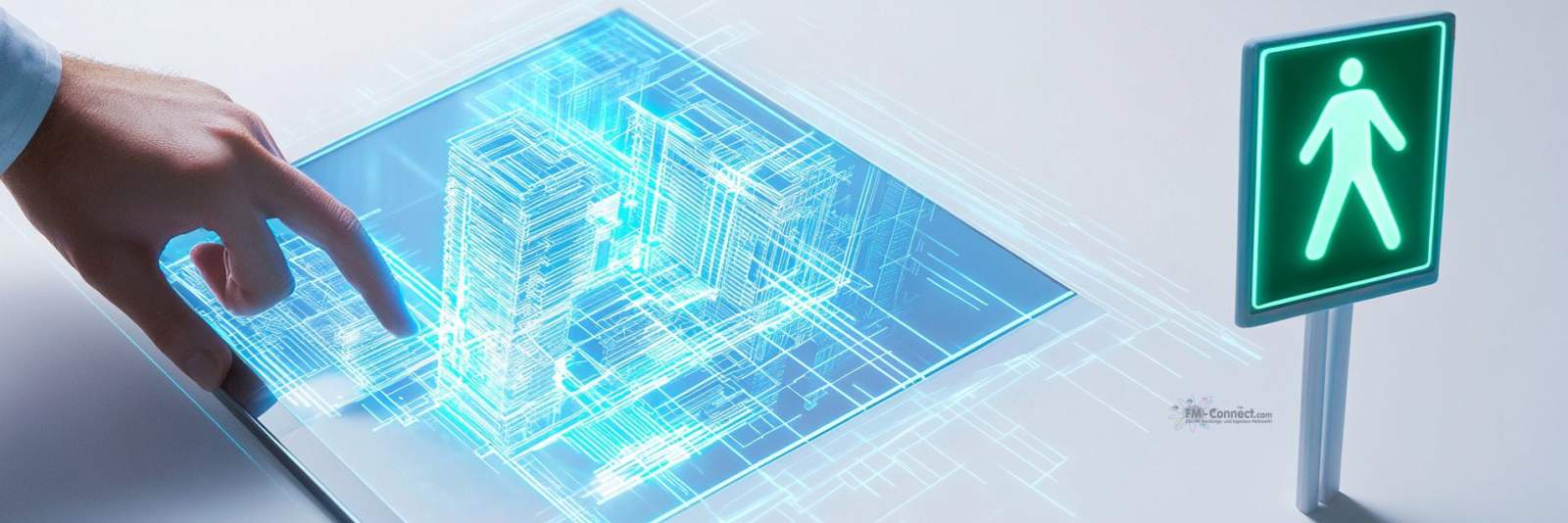
Evakuierungen und Evakuierungskonzepte
Die Planung eines neuen Industriestandorts erfordert ein umfassendes Betriebskonzept, das von Anfang an Sicherheit und Betriebskontinuität gewährleistet. Ein zentrales Element dabei ist ein Evakuierungskonzept im Rahmen des Facility Management (FM). Dieses Konzept sorgt dafür, dass im Gefahrenfall alle Personen – Mitarbeiter, Besucher und Fremdpersonal – schnell und geordnet in Sicherheit gebracht werden können. Aus Sicht der FM-Leitung bedeutet dies, frühzeitig alle erforderlichen organisatorischen, technischen und personellen Maßnahmen zu planen, um den Schutz von Leben und Gesundheit sicherzustellen und zugleich Betriebsunterbrechungen möglichst gering zu halten. Die nachfolgenden Abschnitte erläutern die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die strategischen und technischen Planungsaspekte sowie die interdisziplinären Schnittstellen bei der Erstellung eines Evakuierungskonzepts als Bestandteil eines Betriebskonzepts für industrielle Anlagen.
- Rahmenbedingungen
- Gefährdungsbeurteilung
- Strategische
- Evakuierungsplanung
- Interdisziplinäre
- Implementierung
- Kontinuität
Gesetzliche und normative Rahmenbedingungen
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): Das deutsche Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Arbeitgeber, für Notfälle wie Brände oder andere Gefahrenlagen angemessene Vorkehrungen zu treffen. Insbesondere schreibt §10 ArbSchG vor, „entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind.“ Dabei ist auch die Präsenz anderer Personen (z. B. Besucher, Dienstleister) zu berücksichtigen. Zudem muss der Arbeitgeber Beschäftigte benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung übernehmen – in Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung proportional zu Belegschaftsgröße und Gefährdungen. Dieses Benennen von z.B. Evakuierungshelfern und Brandschutzhelfern stellt sicher, dass im Ernstfall geschulte Personen vor Ort sind, um eine geordnete Räumung einzuleiten. Ferner verlangt §10 ArbSchG, Notfallkontakte zu externen Stellen (Feuerwehr, Rettungsdienst) einzurichten, was in der Praxis etwa die Einbindung lokaler Feuerwehr in die Notfallplanung bedeutet.
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) und Technische Regeln (ASR): Ergänzend zum ArbSchG konkretisiert die ArbStättV die Anforderungen an Sicherheit in Arbeitsstätten. So bestimmt §4 Abs.4 ArbStättV, dass Fluchtwege und Notausgänge jederzeit freigehalten und deutlich gekennzeichnet sein müssen. In größeren oder unübersichtlichen Gebäuden schreibt Anhang 4 der ArbStättV vor, dass Flucht- und Rettungspläne (Evakuierungspläne) gut sichtbar auszuhängen sind. Diese Pläne zeigen den Gebäudegrundriss mit markierten Fluchtwegen, Notausgängen, Sammelstellen und Standorten von Notfalleinrichtungen (Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Stationen). Die ArbStättV verlangt zudem, „in angemessenen Zeitabständen ... entsprechend dem Plan zu üben, wie sich die Arbeitnehmer im Gefahr- oder Katastrophenfall in Sicherheit bringen oder gerettet werden können“. Praktisch bedeutet dies, dass Evakuierungsübungen regelmäßig stattfinden müssen. Die Technische Regel ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ präzisiert diese Vorgaben und empfiehlt, je nach Umstand, alle 2–5 Jahre eine Evakuierungsübung durchzuführen. Dabei sind Faktoren wie Personalwechsel, bauliche Änderungen und menschliche Vergesslichkeit zu berücksichtigen, sodass bei erhöhten Risiken auch häufigere Übungen sinnvoll sein können. ASR A2.3 definiert auch, wann ein Evakuierungsplan erforderlich ist – etwa wenn Fluchtwege nicht sofort erkennbar sind oder das Gebäude komplex strukturiert ist (z. B. große Produktionsstätten oder mehrstöckige Anlagen). In solchen Fällen muss ein Plan erstellt und ausgehängt werden, der den Mindestanforderungen an Gestaltung und Sichtbarkeit entspricht. Zudem fordert ASR A2.3 in Punkt 10 für Betriebe mit besonderen Gefährdungen oder komplizierten Evakuierungsbedingungen, „zu prüfen, ob zusätzliche Anforderungen nach §10 ArbSchG erforderlich sind, wie z. B. die Aufstellung betrieblicher Alarm- und Gefahrenabwehrpläne oder die Erstellung von Brandschutzordnungen oder Evakuierungsplänen.“. Dies unterstreicht, dass etwa bei Industriebetrieben mit erhöhtem Risiko (Chemieanlagen, Explosionsgefahr, etc.) ergänzende Notfallpläne nötig sind – etwa ein betrieblicher Alarmplan, detaillierte Brandschutzordnung (Teil A, B, C) und spezifische Evakuierungsszenarien.
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Die BetrSichV regelt die sichere Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln und Anlagen. Sie verlangt vom Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung vor Inbetriebnahme von Anlagen und die Umsetzung aller Schutzmaßnahmen für den sicheren Betrieb. Dabei müssen auch Notfallszenarien berücksichtigt werden – z. B. Ausfall von Anlagen, Brände oder Freisetzung gefährlicher Energie/Stoffe. So fordert BetrSichV Anhang 1 Nr. 4 z. B. für Aufzugsanlagen einen Notfallplan mit definierten Inhalten. Dieser Notfallplan soll regeln, wie bei steckengebliebenem Aufzug eine rasche Befreiung der Personen erfolgt. Allgemein wird deutlich: Für sämtliche arbeitsmittelbezogenen Risiken (z. B. Druckbehälter, Maschinen mit Brand- oder Explosionsgefahr) müssen im Betriebskonzept Notfallprozeduren vorgesehen sein. Die BetrSichV ergänzt damit die Evakuierungsplanung, indem sie den Fokus auf technische Einrichtungen und deren sichere Abschaltung oder Kontrolle im Notfall legt (z. B. Not-Aus-Schalter, automatische Abschaltungen, Explosionsschutzmaßnahmen). Ein umfassendes Evakuierungskonzept muss diese technischen Gefahrenquellen mit adressieren, um die Evakuierung unter möglichst sicheren Bedingungen zu ermöglichen.
Sicherheitskennzeichnung und Normen: Zur wirksamen Evakuierung gehört eine einheitliche Beschilderung aller Fluchtwege, Ausgänge und Notfallmittel. Die ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ schreibt vor, dass Piktogramme und Sicherheitszeichen dem internationalen Standard DIN EN ISO 7010 entsprechen sollen. Seit 2013 wurden die zuvor national gültigen Symbole (DIN 4844) durch die ISO 7010-Piktogramme ersetzt, um eine europaweit einheitliche Verständlichkeit zu erreichen. Im Ergebnis müssen Notausgänge mit dem grünen Rettungszeichen „laufender Mensch durch Tür“ (ISO-7010 Zeichen E001/E002) gekennzeichnet sein, Erste-Hilfe-Stationen mit dem weißen Kreuz auf Grün, etc. – diese Standards gewährleisten eine sofortige Erkennung von Fluchtwegen auch durch fremde Personen. Ergänzend ist die Norm DIN ISO 23601 relevant, welche Anforderungen an die Darstellung von Flucht- und Rettungsplänen festlegt (Layout, Farbe, Inhalt). Durch Einhaltung dieser Normen im Planentwurf wird sichergestellt, dass Evakuierungsinformationen selbst unter Stress gut lesbar und international verständlich sind. Zusammengefasst bilden ArbSchG, ArbStättV/ASR, BetrSichV sowie die DGUV-Vorschriften und DIN-Normen einen verbindlichen Rahmen, in dem das Evakuierungskonzept zu entwickeln ist – die FM-Leitung trägt Verantwortung für die Einhaltung dieser Vorgaben und muss dies im Betriebskonzept verankern.
Gefährdungsbeurteilung und Evakuierungsplanung
Jede Evakuierungsplanung beginnt mit einer Gefährdungsbeurteilung (Risk Assessment). Gemäß ArbSchG §5 und BetrSichV §3 ist für den neuen Standort systematisch zu analysieren, welche Risiken für Notfälle bestehen. Diese Analyse umfasst interne Gefahrenquellen (z. B. Brand durch Fertigungsprozesse, Explosion von Stoffen, Austritt von Chemikalien, technische Störungen) und externe Gefahren (z. B. Naturereignisse wie Sturm, Hochwasser, Blitzschlag, oder auch Bombendrohungen in Ausnahmefällen). Basierend auf dieser Gefährdungsbeurteilung muss ein Alarmierungs- und Evakuierungskonzept erstellt werden. Die DGUV Information 205-033 formuliert dazu klar: „Die Unternehmerin oder der Unternehmer haben dafür zu sorgen, dass ein Konzept zur Alarmierung und Evakuierung im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung erstellt wird.“. Dieses Konzept definiert für jedes identifizierte Szenario die erforderlichen Maßnahmen. Beispielsweise können bei inneren Gefahren (Brand, Explosion) sofortige Räumung geboten sein, während bei gewissen externen Gefahren (etwa toxische Gaswolke außerhalb) ggf. Shelter-in-Place im Gebäude zeitweise sicherer ist. Solche Entscheidungen fließen in das Konzept ein.
Wesentlich ist, realistische Notfallszenarien durchzuspielen: Wie viele Personen sind maximal im Gebäude? Können alle innerhalb akzeptabler Zeit ins Freie gelangen? Wo entstehen Engpässe? – Hier helfen Simulationen oder Richtwerte aus Normen (z. B. maximal zulässige Fluchtweglängen nach Bauordnung bzw. ASR A2.3, Personenstrom-Studien der BAuA). Bei der Bewertung sollte die FM-Abteilung Experten hinzuziehen, falls intern nicht genügend Fachkompetenz vorhanden ist – etwa die Fachkraft für Arbeitssicherheit, Brandschutzbeauftragte oder externe Berater. Gemeinsam wird festgelegt, welche Schutzziele gelten (z. B. Evakuierung innerhalb von 2 Minuten aus gefährdetem Bereich) und welche Schutzmaßnahmen dafür nötig sind.
Die Gefährdungsbeurteilung bildet somit die Grundlage, um Evakuierungsstrategien festzulegen: etwa eine vollständige Gebäudeevakuierung vs. bereichsweises Räumen (z. B. in Krankenhäusern nur betroffene Station), Evakuierung über redundante Fluchtwege, Einsatz von Rettungsgeräten (Rettungstücher, Evakuierungsstühle für Behinderte in Treppenhäusern) usw. Auch besondere Personengruppen sind zu berücksichtigen: Menschen mit Mobilitätseinschränkungen benötigen barrierefreie Rettungswege oder Assistenz; Fremdfirmen und Besucher müssen im Alarmfall betreut und gezählt werden. Das Evakuierungskonzept sollte solche Details bereits in der Planungsphase antizipieren. Nicht zuletzt müssen Sammelstellen im Freien definiert werden, die ausreichend Abstand zum Gebäude haben und sicher erreichbar sind. Diese Sammelpunkte werden in den Plänen markiert und dienen der Vollzähligkeitskontrolle nach der Räumung.
Ein systematisches Risiko-Management bedeutet auch, Wechselwirkungen zu bedenken: Beispielsweise können in einem Logistiklager Gabelstapler-Batterien brennen (Brand- und Rauchgefahr) – entsprechend braucht es Rauchmelder und eine Alarmierung, aber auch eine Überlegung, ob man im Alarmfall Lüftungsanlagen abschaltet, um Rauchabsaugung oder -begrenzung zu steuern. In einer Chemieproduktion wiederum ist bei Austritt gefährlicher Stoffe eventuell nicht Feuer der Hauptaspekt, sondern giftige Gase – hier müssen Evakuierungsrouten ggf. so gewählt werden, dass sie nicht durch kontaminierte Bereiche führen, oder es müssen Atemschutzmasken bereitgestellt werden für die Belegschaft. Solche Szenario-Analysen fließen in das Evakuierungskonzept ein. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ist schlussendlich ein klar beschriebenes Evakuierungskonzept mit Alarmierungswegen, Zuständigkeiten, Ablaufplänen und technischen Hilfsmitteln, welches integraler Bestandteil des gesamten Betriebskonzepts wird.
Strategische Planung in der Entwurfsphase
Frühe Einbindung aller Beteiligten: Bereits in der Planungs- und Bauphase eines neuen Industriestandorts muss das Facility Management seine Expertise einbringen, um spätere Sicherheit im Betrieb zu garantieren. Eine enge Abstimmung „zwischen Architekten, Planern und Betreibern von Beginn an“ ist erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass bauliche Faktoren wie Fluchtwege, Brandschutz und auch Barrierefreiheit gleichrangig mit Produktions- und Nutzungsaspekten berücksichtigt werden und nicht nachträglich teuer umgeplant werden müssen. In der Praxis bedeutet dies: Die Anzahl und Lage der Notausgänge muss schon im Bauplan festgelegt werden (entsprechend Bauordnung und ASR-Vorgaben), ebenso die Dimensionierung von Fluren und Treppenhäusern (Mindestbreiten gemäß Personenanzahl). FM-Manager sollten in dieser Phase Anforderungen aus Regelwerken einbringen, z. B. dass ein Gebäude ab einer gewissen Größe mindestens zwei voneinander unabhängige Flucht- und Rettungswege pro Aufenthaltsbereich benötigt (Bauordnungsrecht) und dass Rettungswege möglichst „kurz, direkt und jederzeit zugänglich“ sein müssen. Auch Einbauten wie Brandschutztüren, Rauchschürzen oder Notbeleuchtung werden in der Entwurfsplanung vorgesehen, um im Ernstfall sichere Bereiche zu schaffen und Orientierung zu bieten.
Ein wichtiger Aspekt ist die Integration von Sicherheitstechnik: Das Evakuierungskonzept muss Alarmierungsanlagen (Brandmeldeanlagen mit Sirenen/Durchsagen), Rauchabzugsanlagen, Notstrom für Notbeleuchtung und ggf. Sicherheitsauflagen wie Druckbelüftungen in Treppenhäusern umfassen. Diese technischen Einrichtungen sollten während der Bauplanung vorgesehen und im Betriebskonzept beschrieben werden. Beispielsweise ist in mehrstöckigen Industriegebäuden oft eine Rauchschutz-Druck-Anlage (RDA) im Treppenhaus empfehlenswert, um im Brandfall den Fluchtweg rauchfrei zu halten. Solche Anlagen beeinflussen wiederum die Türen (Selbstschließer, ggf. Druckknöpfe etc.), was frühzeitig zwischen Architekt, Türausrüster und FM abgestimmt werden muss. Auch die Position von Feuerlöschern, Wandhydranten und Erste-Hilfe-Stationen wird optimalerweise schon im Layout geplant, damit sie gut erreichbar und in den Fluchtplänen verzeichnet sind.
Das Facility Management achtet in der Planungsphase ferner darauf, dass Sammelplätze auf dem Werksgelände eingeplant werden – idealerweise windabgewandt und fern von Gefahrenquellen (z. B. nicht neben einer Gefahrgutlagerhalle). Gegebenenfalls müssen auf dem Außengelände Lautsprecher oder Sirenen installiert werden, damit auch dort Alarmierungen gehört werden. Zudem ist zu klären, wo ein Einsatzleiter (Evakuierungsleiter) sich postiert und kommuniziert (Stichwort: Einsatzzentrale oder Feuerwehr-Anlaufstelle mit Feuerwehrplan-Kasten am Zugang). All dies fließt in ein Betriebskonzept ein Dokument, das die Betriebsbereitschaft und Sicherheit der neuen Anlage beschreibt. Ein solches Dokument entsteht in iterativer Abstimmung zwischen den Planungsbeteiligten und wird vor Inbetriebnahme von z.B. Sachverständigen oder Behörden überprüft.
Bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen der Evakuierungsplanung
Eine effektive Evakuierung setzt eine Kombination aus baulichen/technischen Vorkehrungen und organisatorischen Regelungen voraus.
Im Folgenden werden die wichtigsten Maßnahmen erläutert, die im Evakuierungskonzept festgehalten werden:
Fluchtwege und Notausgänge: Alle Flure, Gänge und Türen, die als Fluchtweg dienen, müssen gut passierbar und ausreichend breit sein (ASR A2.3 definiert z. B. Mindestbreiten je nach Personenzahl). Hindernisse sind strikt zu vermeiden – das FM sorgt für eine Hausordnung, die das Abstellen von Gegenständen in Fluchtwegen verbietet. Türen auf Fluchtwegen sind möglichst in Fluchtrichtung aufschlagend und mit Panikverschlüssen (nach DIN EN 179/EN 1125) ausgestattet, damit sie jederzeit nach außen öffnen. Notausgänge müssen nach außen ins Freie oder in sichere Nachbarbereiche führen und eindeutig mit Rettungszeichen beschildert sein (ISO 7010 „Exit“-Piktogramme). Technisch sind Notausgangstüren oft mit Alarm oder Fluchttürsteuerungen versehen, die bei Missbrauch warnen, aber im Notfall auf Druck sofort öffnen.
Not- und Sicherheitsbeleuchtung: Gemäß Arbeitsstättenrecht und DIN EN 1838 ist für Fluchtwege eine Sicherheitsbeleuchtung vorzusehen, falls der Strom ausfällt. Dadurch werden Wege und Ausgänge mindestens 1 Lux hell beleuchtet, damit niemand im Dunkeln stolpert. Leuchtende oder nachleuchtende Markierungen am Boden (DIN 67510) können zusätzlich Orientierung bieten (z. B. in verqualmten Bereichen). Piktogrammschilder nach ISO 7010 sind in langnachleuchtender Ausführung zu verwenden, sodass sie im Dunkeln sichtbar sind.
Alarmierungssystem: Eine klare Alarmierungsstrategie ist Teil des Konzepts. Oftmals wird bei Industriebetrieben ein akustischer Alarmton (Sirene, Horn) eingesetzt, kombiniert mit Sprachdurchsagen, um Anweisungen zu geben. In Lärmbereichen (z. B. laute Produktion) kommen optische Signalgeber (Blitzleuchten) hinzu. Das Konzept definiert, wer den Alarm auslöst und wie die Information verbreitet wird – etwa automatisch durch Brandmeldezentrale oder manuell durch einen Evakuierungsleiter. Alarmierungspläne legen fest, welche Kommunikationsmittel genutzt werden (Durchsagesysteme, SMS-Warnsystem, Lautsprecher) und enthalten Eskalationsstufen (z. B. Teilräumung vs. Gesamträumung). Wichtig ist auch die Verbindung zur örtlichen Feuerwehr: Entweder automatische Alarmweiterleitung oder klare Anweisung, wer die Feuerwehr verständigt. Das ArbSchG fordert, dass „im Notfall erforderliche Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen ... eingerichtet sind“ – typischerweise ein Telefon mit Notrufliste an der Pforte oder ein Brandmelder, der direkt auf die Feuerwehr aufgeschaltet ist.
Evakuierungsorganisation und Zuständigkeiten: Ein schriftlich fixierter Evakuierungsplan regelt die Abläufe und Verantwortlichkeiten im Ereignisfall. Darin ist festgelegt, wer bei Alarm welche Aufgaben übernimmt. Üblicherweise wird ein Evakuierungsleiter benannt (z. B. Schichtführer oder FM-Verantwortlicher), der das Kommando übernimmt, sowie Evakuierungshelfer pro Abteilung/Stockwerk, die die Räumung ihrer Bereiche koordinieren. Nach §10 ArbSchG müssen Anzahl und Ausbildung dieser Helfer an die Betriebsgröße und Gefahren angepasst sein. Evakuierungshelfer gehen bei Alarm systematisch durch ihr Gebiet, fordern alle Anwesenden zum Verlassen auf, überprüfen Toiletten und Nebenräume, unterstützen Hilfsbedürftige und melden dem Evakuierungsleiter, wenn ihr Bereich geräumt ist. Eine Mitarbeiter-Unterweisung stellt sicher, dass alle Beschäftigten die Alarmzeichen, Fluchtwege und Sammelplätze kennen. Neue Mitarbeiter und Fremdfirmen sind frühzeitig in die Sicherheitsbestimmungen einzuweisen. Auch Besucherregelungen (Besucherausweise mit Hinweis auf Fluchtwege, Begleitung durch Mitarbeiter im Notfall) gehören dazu. Zur Organisation zählen außerdem klare Regeln, dass niemand ohne Freigabe ins Gebäude zurückkehrt und dass Produktionsprozesse – soweit gefahrlos machbar – gesichert heruntergefahren werden (z. B. Maschinen in sicheren Zustand bringen, offene Feuer löschen). Diese Prozeduren sollten als betriebliche Anweisung dokumentiert sein.
Brandschutzordnung und Notfallpläne: In Deutschland wird üblicherweise eine Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A, B, C erstellt. Teil A (für alle Personen) hängt im Gebäude aus und enthält einfachste Verhaltensregeln im Brandfall (Ruhe bewahren, melden, retten, löschen). Teil B (für Mitarbeiter) und Teil C (für Führungskräfte/Fachpersonal) liegen intern vor und regeln detaillierte Verantwortlichkeiten und Maßnahmen. Eine solche Brandschutzordnung ist integraler Bestandteil des Evakuierungskonzepts. Darüber hinaus können spezifische Notfall- und Gefahrenabwehrpläne für bestimmte Szenarien erstellt werden, z. B. Explosionsschutzplan, Plan für Gefahrstoffaustritt, Amok-/Bedrohungslagen (bei entsprechenden Risiken). Diese Pläne enthalten Maßnahmen, die über die allgemeine Evakuierung hinausgehen, etwa Absperrung eines Bereichs, Alarmierung von Spezialkräften, etc. – stets in Abstimmung mit behördlichen Auflagen und dem Werkschutz/Security.
Beispiel eines Flucht- und Rettungsplans für eine industrielle Anlage (Grundriss mit Fluchtwegen, Notausgängen, Sammelplatz und Handlungsanweisungen).
Im Evakuierungskonzept werden alle vorgenannten Informationen in schriftlicher und visueller Form zusammengeführt. Flucht- und Rettungspläne werden gemäß ASR A2.3 erstellt und an gut sichtbaren Stellen im Gebäude ausgehängt – typischerweise an Ein- und Ausgängen, in Aufenthaltsräumen, an zentralen Infotafeln. Diese Pläne zeigen den aktuellen Gebäudegrundriss mit markierten Fluchtwegen, Standorten von Feuerlösch- und Erste-Hilfe-Einrichtungen, Notausgängen sowie den Sammelstellen im Freien. Zudem sind auf jedem Plan klare Verhaltensanweisungen abgedruckt (z. B. „Bei Alarm: Betrieb einstellen, nächste Notausgänge benutzen, zum Sammelplatz X gehen, über Notruf 112 Feuerwehr alarmieren“). Durch regelmäßige Wartung und Aktualisierung der Pläne und der sicherheitstechnischen Einrichtungen (Feuermelder-Prüfungen, Notbeleuchtungstests, Wartung Löschanlagen) stellt das FM sicher, dass die Angaben immer korrekt sind und alle Anlagen im Ernstfall funktionieren. Änderungen (z. B. Umbauten, geänderte Raumnutzungen) erfordern eine umgehende Anpassung der Dokumentation. Ebenso müssen die Kontaktdaten im Alarmplan stets aktuell sein.
Interdisziplinäre Schnittstellen: FM, Arbeitsschutz und Notfallmanagement
Ein schlüssiges Evakuierungskonzept entsteht durch die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche. Facility Management nimmt dabei die koordinierende Rolle ein, insbesondere in der Implementierungsphase eines neuen Standorts. Die FM-Abteilung arbeitet eng mit dem Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit (Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt) zusammen, um sicherzustellen, dass alle betrieblichen Abläufe und Einrichtungen den Sicherheitsanforderungen genügen. Gemeinsam werden Schulungen konzipiert, Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt und Verbesserungen erarbeitet. Die Leitung FM hat aus betriebsorganisatorischer Sicht den Überblick über Gebäudetechnik, Infrastruktur und Ablaufprozesse – dieses Wissen fließt in Notfallpläne ein, z. B. welche technischen Anlagen im Notfall abzuschalten sind (Lüftungen, Maschinen) oder wo Gefahrenstoffe lagern, die für die Feuerwehr relevant sind.
Wichtig ist auch die Schnittstelle zum betrieblichen Brandschutz und Werkschutz. In vielen Industriebetrieben gibt es Brandschutzbeauftragte oder gar eine Werkfeuerwehr. Das Evakuierungskonzept muss mit deren Brandschutzkonzept abgestimmt sein, damit Löschmaßnahmen und Evakuierungsmaßnahmen Hand in Hand greifen. Beispielsweise wird festgelegt, ob Beschäftigte zunächst Löschversuche unternehmen oder sofort evakuieren; oder ob bestimmte Personen eine Brandmeldeanlage manuell auslösen dürfen. Werkschutz/Security spielt eine Rolle bei der Absicherung des Geländes während einer Evakuierung – etwa um Zutritt Unbefugter oder Diebstahl zu verhindern, wenn Gebäude offen stehen. Diese Kräfte können Eingänge bewachen, sobald geräumt ist.
Für den Notfall selbst ist eine klare Kommando- und Kommunikationsstruktur entscheidend. Hier zeigt sich gelebte Interdisziplinarität: In einem größeren Unternehmen wird oft ein Notfall- oder Krisenstab eingerichtet, dem Vertreter verschiedener Bereiche angehören. So sollten laut Fachliteratur und Praxis „wesentliche Funktionsträger, wie z. B. Leiter Technik, Facility Manager (FM), Leiter Werkschutz, Leiter Einkauf, Unternehmenskommunikation“ in einer Notfallorganisation vertreten sein. Die Unternehmensleitung delegiert im Ereignisfall an diesen Kreis die operative Einsatzleitung. FM-Leiter bringen dabei ihre Kenntnis der Gebäudeinfrastruktur ein (z. B. welche Bereiche bereits evakuiert sind, wie man Lüftungsanlagen steuert, wo Einsatzkräfte Zugang bekommen). Arbeitsschutzexperten achten auf die sichere Durchführung (z. B. Schutz der Evakuierenden vor Rauch, persönliche Schutzausrüstung), Werkschutz koordiniert Absperrungen und Hilfestellung, Kommunikation kümmert sich um interne und externe Information (Mitarbeiterinfos, Presse ggf.). Dieses Team bildet im Ernstfall die Entscheidungsinstanz und steht im engen Kontakt zu externen Einsatzleitungen.
Die Zusammenarbeit mit externen Rettungskräften sollte bereits im Vorfeld etabliert und geübt werden. Empfohlen wird, Feuerwehr und Polizei „bereits in die frühen Planungsphasen ... einzubeziehen“, um von deren Expertise zu profitieren und Anforderungen abzustimmen. Regelmäßige Besprechungen und gemeinsame Übungen stärken das gegenseitige Verständnis. Beispielsweise kann die lokale Feuerwehr Beratung geben, ob die Zufahrten für Löschfahrzeuge ausreichend sind, ob spezielle Feuerwehrpläne benötigt werden und wo ein Feuerwehrschlüsseldepot anzubringen ist. Bei Großbetrieben organisiert man idealerweise jährliche gemeinsame Übungen mit der Feuerwehr, um die Abläufe zu testen (inklusive Einsatz einer gemeinsamen Einsatzleitung vor Ort). Die interne Notfallorganisation verbindet sich „mit der eintreffenden Feuerwehr und Polizei ... sobald wie möglich zu einer gemeinsamen Einsatzleitung“, sodass Informationen ausgetauscht und Maßnahmen abgestimmt werden können. Diese Verzahnung stellt sicher, dass z. B. Feuerwehrleute wissen, ob noch Personen vermisst werden oder welche besonderen Gefahren (Chemikalien, Gasflaschen) im Objekt sind – Informationen, die das FM bereitstellt.
Auch mehrere Unternehmen am Standort (z. B. Industrieparks mit Mietern oder benachbarte Firmen) stellen eine Herausforderung dar. Gemäß ArbSchG §8 sind Arbeitgeber bei gemeinsamer Arbeitsstätte zur Koordination des Arbeitsschutzes verpflichtet. Praktisch heißt das, es muss ein abgestimmtes übergreifendes Evakuierungskonzept geben, damit nicht jeder Betrieb isoliert agiert. Im Gefahrfall darf keine „gegenseitige Gefährdung“ entstehen. Oft wird ein Objektverantwortlicher oder Koordinator benannt, der im Notfall die Abstimmung übernimmt. Das FM kann hier moderierend wirken, indem es beispielsweise regelmäßige Treffen mit Vertretern aller ansässigen Firmen organisiert, um Alarmpläne und Evakuierungswege abzustimmen. Bei gemischten Arealen (z. B. Produktion neben Logistiklager) ist abzuklären, ob ein Alarm in einem Betriebsteil automatisch die anderen mit evakuieren soll oder nicht – solche Festlegungen fließen in schriftliche Objekt-Notfallpläne ein.
Insgesamt nimmt die FM-Leitung eine Schlüsselstellung ein: Sie muss die Compliance mit allen Vorschriften sicherstellen, die Ressourcen für Sicherheitsmaßnahmen einplanen (etwa Budget für Beschilderung, Übung und Schulung bereitstellen) und im Ernstfall auch die Wiederanlaufprozesse koordinieren. Die Schnittstellen zu Arbeitssicherheit, Brandschutz und externen Behörden erfordern von FM-Führungskräften ein breites Verständnis und proaktives Handeln – eine Aufgabe, die über rein technische Gebäudeunterhaltung weit hinausgeht und Aspekte des Emergency- und Continuity-Managements einschließt.
Implementierung in verschiedenen Anlagentypen
Industrie ist nicht gleich Industrie – das Evakuierungskonzept muss die branchenspezifischen Besonderheiten und den Anlagentyp berücksichtigen.
Zwar gelten die beschriebenen Prinzipien (Fluchtwege, Alarmierung, Helfer etc.) überall, doch im Detail gibt es Unterschiede:
Produktionsbetriebe (Fertigungsanlagen): Hier stehen oft Maschinen und Prozesse im Vordergrund. Gefahren können von z.B. schweren Maschinen, Öfen, Chemikalien oder Druckbehältern ausgehen. Ein Betriebskonzept muss daher vorsehen, wie im Notfall Maschinen sicher heruntergefahren oder in einen sicheren Zustand versetzt werden, um Folgeschäden (Explosion, Auslaufen von Schmelze etc.) zu verhindern. Evakuierungswege in Produktionshallen müssen so geplant sein, dass Mitarbeiter auch dann fliehen können, wenn ein Bereich durch ein Ereignis blockiert ist – etwa durch mehrere Ausgänge an verschiedenen Hallenseiten. In Fertigungsstätten kommt hinzu, dass persönliche Schutzausrüstung (Helme, Gehörschutz) teilweise während der Evakuierung getragen werden muss; die Verständigung in lauter Umgebung ist ein Thema, weshalb optische Alarme oder Pager sinnvoll sein können. Außerdem sind regelmäßig Schichtbetriebe betroffen – das Konzept muss 24/7 gelten und zu ungewöhnlichen Zeiten (Nacht) ebenso funktionieren. In bestimmten Branchen (z. B. Chemie, Petrochemie) sind erweiterte Alarmpläne nötig, die auch das Umfeld warnen (Werksirenen, Anwohner-Informationssysteme), und es greifen zusätzlich Störfall-Verordnungen mit behördlich geprüften Sicherheitsberichten. FM muss hier eng mit HSE (Health, Safety & Environment) Experten arbeiten, um alle Auflagen zu erfüllen.
Logistik- und Lagerhallen: In Logistikzentren sind die Hauptgefahren oft Brände (insbesondere bei Hochregallagern, stark brennbare Waren wie Papier, Textilien, Kunststoff). Das Evakuierungskonzept muss der großen Fläche und Höhe Rechnung tragen: Mitarbeiter auf Flurförderzeugen oder Kommissionierbühnen müssen Warnungen rechtzeitig erhalten, eventuell über Funk. Die Fluchtwege in weitläufigen Hallen werden durch Beleuchtung und Beschilderung unterstützt, ggf. auch durch farbige Bodenmarkierungen. Da hier viele fahrerlose Transportsysteme oder Gabelstapler im Einsatz sein können, muss geklärt sein, ob diese bei Alarm automatisch stoppen (um Kollisionen mit fliehenden Personen zu vermeiden). Logistikhallen haben oft Laderampen und Tore – das Konzept sollte definieren, ob z.B. Tore bei Alarm öffnen, um zusätzliche Ausgänge zu bieten, und wie mit anwesenden Fremd-LKW-Fahrern verfahren wird (diese müssen in Sammelplätze integriert werden). Bei Kältehallen wiederum besteht die Herausforderung, dass im Freien extreme Temperaturen herrschen können – hier könnte das Betriebskonzept vorsehen, wärmende Decken an Sammelpunkten bereitzuhalten. Die Brandabschnittsbildung und Rauchabsaugung sind in solchen Bauten kritisch, um Evakuierungswege rauchfrei zu halten. Regalbediengeräte oder andere automatische Anlagen sollten so abgesichert sein, dass sie bei Brandalarm in Grundposition fahren, damit sie Fluchtwege nicht versperren (dies fließt in die Anlagensicherheit, geregelt in BetrSichV/Technischen Regeln).
Montage- und Werkstätten, Labore: In Werkstätten besteht neben Brandgefahr auch erhöhtes Unfallrisiko. Das Evakuierungskonzept muss hier ggf. kombinierte Szenarien betrachten, z. B. Evakuierung + Erstversorgung Verletzter. Die Nähe zwischen Arbeitsschutz und Evakuierungsplanung zeigt sich: Man plant z.B., dass Ersthelfer (ausgebildet nach DGUV-Richtlinien) verfügbar sind, die im Notfall auch beim Verlassen Verletzte mitnehmen oder an Sammelstellen medizinisch betreuen. In Laboratorien oder Anlagen mit Gefahrstoffen müssen Notfallausrüstungen (Augenduschen, Notduschen) selbst im Evakuierungsfall genutzt werden können – d.h. Fluchtpläne markieren diese Einrichtungen, und die Evakuierung darf erst erfolgen, nachdem etwa kontaminierte Personen sich notdürftig dekontaminiert haben, um andere nicht zu gefährden. So etwas bedarf besonderer Prozeduren und Übungen.
Büro- und Verwaltungsgebäude innerhalb des Industriestandorts: Zwar sind Büros weniger risikobehaftet, doch auch hier sind Evakuierungen (z. B. wegen Gebäudebrand, Bombendrohung) möglich. Das Konzept sollte für gemischte Standorte berücksichtigen, dass Verwaltungsmitarbeiter und Produktionsmitarbeiter unterschiedlichen Gefahren begegnen. Im Alarmfall ist die Kommunikation zwischen diesen Bereichen wesentlich – etwa, dass ein Alarm in der Produktion auch im Verwaltungsgebäude hörbar ist, falls beide betroffen sein könnten. Bei getrennten Alarmzonen muss das FM sicherstellen, dass keine Alarm-Müdigkeit auftritt (z. B. regelmäßige Drills auch im Büro durchführen, obwohl dort die Wahrscheinlichkeit eines Brandes geringer scheint). Zudem sind in Büros eventuell Besucher in größerer Zahl (Kunden, Bewerber, etc.), weshalb klare Besucherregistrierung und -lenkung im Notfall nötig ist.
Der Leitfaden für FM lautet: das Evakuierungskonzept muss maßgeschneidert sein. Es gibt kein Einheitskonzept für alle Industriezweige. Daher sollten FM-Verantwortliche relevante Regelwerke der Branche kennen – z. B. besondere Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Für Logistik gibt es etwa DGUV-Regeln zur Lagerung, für Chemie Seveso-Richtlinie (Störfall) etc., die in Notfallplanungen hineinspielen. Die Aufgabe der FM-Leitung ist es, diese Anforderungen in eine kohärente Gesamtstrategie für den Standort zu integrieren. So entsteht ein Betriebskonzept, das für jeden Anlagentyp robuste Evakuierungsmaßnahmen vorsieht und dennoch flexibel bleibt, um unerwartete Lagen bewältigen zu können.
Kontinuität, Resilienz und kontinuierliche Verbesserung
Ein durchdachtes Evakuierungskonzept zahlt nicht nur auf die Sicherheit der Mitarbeiter ein, sondern auch auf die Betriebskontinuität und Resilienz des Unternehmens. Ein Gesichtspunkt für FM-Leitungen ist das Business Continuity Management (BCM) – also die Vorbereitung darauf, den Geschäftsbetrieb nach einem Zwischenfall schnell wieder aufnehmen zu können. Dazu gehört, dass bereits im Betriebskonzept festgelegt wird, wie nach einer Evakuierung vorgegangen wird: Gibt es z.B. Ausweichstandorte oder Notfall-Büros, wohin Mitarbeiter im Falle eines längeren Gebäudeverlusts gehen können? Wie werden Daten gesichert, Maschinen heruntergefahren, Kunden informiert? Zwar liegen diese Punkte teils außerhalb der unmittelbaren Evakuierung, aber sie knüpfen nahtlos daran an. Die FM-Abteilung muss Schnittstellen zum Krisenmanagement haben – etwa bei größeren Schadenslagen (Brand, Explosion) mit dem Management entscheiden, ob und wann Mitarbeiter heimgeschickt werden oder wann die Produktion in anderen Werken kompensiert wird. Solche Überlegungen können in einem umfassenden Betriebskonzept skizziert werden, um im Ernstfall Handlungssicherheit zu haben.
Resilienz bedeutet auch, aus Übungen und Vorfällen zu lernen. Daher ist ein ständiger Verbesserungsprozess Teil der Evakuierungsplanung. Nach jeder Übung sollte Feedback eingeholt werden – was hat gut funktioniert, wo gab es Probleme? Beispielsweise könnten Beobachter (intern oder von der Feuerwehr) bei Übungen postiert werden, die den Ablauf protokollieren. Typische Schwachstellen (etwa zu langsames Verlassen, unklare Sammelplatzzuordnung, technische Alarmsirene nicht hörbar etc.) können so identifiziert werden. Die Dokumentation aller Übungen und tatsächlichen Evakuierungen, inklusive einer Mängelliste, ermöglicht es dem FM-Team, gezielte Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. Das Konzept selbst ist kein statisches Papier, sondern wird regelmäßig überprüft und aktualisiert. Veränderungen – sei es baulich (Umbau, neue Lagerregale), personell (andere Mitarbeiterzahl, andere Behinderte im Team) oder organisatorisch (neue Schichtmodelle) – erfordern eine Anpassung der Evakuierungspläne. Rechtsänderungen oder neue anerkannte Regeln (z. B. geänderte ASR oder Normen) müssen ebenso eingearbeitet werden. Die VDI-Richtlinie 4062 empfiehlt z.B. ausdrücklich, Evakuierungskonzepte regelmäßig zu prüfen und zu aktualisieren, um rechtliche Konformität und Effektivität sicherzustellen.
Für die FM-Leitung bedeutet dies, im Rahmen des Qualitätsmanagements einen Prozess zu etablieren, der das Notfallkonzept lebt. Das kann über jährliche Reviews im Arbeitsschutzausschuss geschehen oder durch Audits. Compliance-Nachweise gegenüber Behörden oder Auditoren (z. B. im Rahmen von ISO-Zertifizierungen für Arbeitsschutz) werden so erbracht, indem die Dokumentation zeigt, dass alle Auflagen erfüllt sind. Sollte ein echter Notfall eintreten, hat eine gründliche Vorbereitung unmittelbaren Nutzen: Mitarbeiter verhalten sich routinierter und panikfreier, Sachschäden können minimiert und Ausfallzeiten reduziert werden. Statistisch stehen Unternehmen, die auf Notfälle nicht vorbereitet sind, vor erheblichen finanziellen Verlusten oder gar dem Unternehmensaus – ein Risiko, dem durch präventive Evakuierungsplanung begegnet wird.
Schließlich steigert ein solides Evakuierungskonzept auch die Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit: Beschäftigte spüren, dass ihr Arbeitgeber Fürsorge ernst nimmt und für ihre Sicherheit sorgt. Dies trägt zur Entwicklung einer positiven Sicherheitskultur bei, in der jeder vom Werker bis zur Führungskraft sensibilisiert ist. Das Facility Management fungiert hier als Vorbild und Treiber, indem es Sicherheitsaspekte in alle betrieblichen Entscheidungen integriert – getreu dem Motto: Safety first. Ein resilienter Betrieb ist das Ergebnis dieser gemeinsamen Anstrengung.
